„There are always more smart people outside your company than within it.“
Open Innovation in Unternehmen
Prozesse und Strukturen zur Innovationsentwicklung werden im klassischen Innovationsmanagement intern in der Organisation verankert und vor allem vom Unternehmensumfeld abgeschirmt.
Open Innovation bricht mit diesem klassischen Verständnis. Open Innovation umfasst alle Prozesse, Strukturen und Methoden, die den bewussten Daten- und Informationsaustausch mit dem externen Unternehmensumfeld ermöglichen und fördern. Dieser Daten-, Informations-, Wissens- und Ideenaustausch zwischen einem Unternehmen und seinem Umfeld beschleunigt die Ideenentwicklung und Innovationsprozesse, und gestaltet sie zudem effizienter im Vergleich zum Innovationsmanagement im klassischen Sinne.
Open Innovation: Kurz zusammengefasst
Externe Daten und externes Wissen werden in den Innovationsprozess internalisiert, während ebenso interne Daten und Informationen an das externe Unternehmensumfeld veröffentlicht werden.
Es gibt drei übergeordnete Formen der Open Innovation: Outside-In-Prozess, Inside-Out-Prozess und Coupled-Prozess (Kombination aus Outside-In und Inside-Out).
Zentrale Vorteile der Open Innovation sind unter anderem Partizipation an externem Wissen und externer Kreativität, Kostenersparnisse und Risikoteilung.
Was ist Open Innovation?
Die Grundannahme von Open Innovation ist, dass auch große Unternehmen aufgrund steigender Komplexitäten und Dynamiken nicht mehr über alle Fähigkeiten und Ressourcen verfügen können, die für Innovationen notwendig sind. Unternehmen müssen daher auf der einen Seite externes Wissen in ihre internen Prozesse einbinden um die Innovationsfähigkeit gewährleisten zu können. Auf der anderen Seite werden bei einigen Formen der Open Innovation Informationen und Wissen innerhalb der Organisation auch nach außen gegeben. Beispiele hierfür sind Innovationswettbewerbe oder öffentlich zur Verfügung gestellte Software (Open Source). Nähere Erklärungen und Beispiele zu den unterschiedlichen Formen der Open Innovation werden weiter unten im Text erklärt.
Henry Chesbrough, der den Begriff der Open Innovation prägte, definiert Open Innovation wie folgt: Open Innovation is „a distributed innovation process based on purposively managed knowledge flows across organizational boundaries, using pecuniary and non-pecuniary mechanisms in line with the organization’s business model“ Chesbrough, H. & Bogers M. , 2014, S. 3.
Open Innovation kann man also als eine symbiotische Beziehung der Organisation mit ihrer Außenwelt betrachten, für die ein Unternehmen als Grundvoraussetzung eine „not invented here“ Einstellung als Teil der Unternehmenskultur entwickeln muss. Denn die klassische Denkweise und Mentalität, dass Innovationen aus dem Inneren der Organisation heraus kommen müssen, ist insbesondere im Mittelstand noch immer weit verbreitet.
Wann ist Open Innovation sinnvoll?
Open Innovation wird häufig in intermediären Märkten eingesetzt, in denen Entrepreneure oft auch in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen hochspezialisierte technologische Lösungen für Unternehmen und Großkonzerne entwickeln. Die Unternehmen, die nicht über das Know-how und die Ressourcen für eine Eigenentwicklung verfügen, lagern somit Innovationsbereiche, teilweise in Form von strategischen Partnerschaften aus. Ideen oder Teil-Lösungen, die sich aus den strategischen Partnerschaften ergeben, werden dann zu fertigen Marktprodukten transformiert.
Ein Beispiel hierfür ist die Technologie für selbstfahrende Autos. Da diese Technologie derart komplex und hochspezialisiert ist, wird sie von BMW gemeinsam mit Mercedes, Bosch und Siemens erforscht und entwickelt. Das Paradigma der Open Innovation lässt sich somit als Antwort auf die steigende Komplexität der Bedingungen verstehen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Open Innovation erhöht also den externen und internen Informations- und Wissensaustausch und somit die Resonanzfähigkeit des Unternehmens. Im Sinne von Ashby’s Law wird also mit Hilfe von Open Innovation ein komplexes Lösungssystem entwickelt, das die steigende Komplexität des Problemsystems, dem ein Unternehmen ausgesetzt ist, ausgleicht.
Beispiel für Open Innovation
Ausgerechnet die NASA, die als die Organisation mit den weltweit besten Forschern und Wissenschaftlern gilt, ist ein beeindruckendes Beispiel für erfolgreiche Open Innovation.
Heliophysik-Experten der NASA hatten bereits viele Jahre und Ressourcen aufgewendet um bessere Vorhersagen von Sonneneruptionen treffen zu können. Die Vorhersagen konnten allerdings mit Hilfe der damaligen Algorithmen auf maximal zwei Stunden vorhergesagt werden, und auch das nur mit einer Genauigkeit von 50 Prozent.
Dieses Ergebnis war nicht zufriedenstellend, so dass man die Aufgabe der Suche nach einer besseren Lösung 2009 veröffentlichte. Mehr als 500 Personen nahmen an diesem öffentlichen Innovationswettbewerb teil und immerhin 11 ernstzunehmende Lösungen wurden zu diesem hoch komplexen Problem eingereicht.
Der von einem pensionierten Radiotechnikers aus New Hampshire eingereichte Vorschlag gewann letztendlich den Open Innovation Wettbewerb. Statt satellitengestützter Daten, wie sie die NASA Ingenieure verwendeten, basierte die Lösung des Radiotechnikers auf einem Algorithmus der mit Daten von Bodenfunkgeräten arbeitete. Eine vermeintlich simple Lösung, die Sonneneruptionen aber acht Stunden im Voraus und mit einer Genauigkeit von 75 Prozent berechnen konnte.
Interessant ist vor allem die Tatsache, dass der pensionierte Radiotechniker einen Lösungsansatz wählte, der völlig außerhalb der in der NASA vorherrschenden Denkmustern und Wissensarbeiten lag. Das zeigt, wie mit Hilfe von Open Innovation bestehende Denkmuster und Routinen zugunsten innovativer Lösungen durchbrochen werden können.
Vorteile der Open Innovation
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
Kosten- und Risikoteilung
Zugang zu externen Kompetenzen / Ressourcen
Einlizensierung von Technologien
Integrierte Lösung
Durchbrechen von bestehenden Denkmustern und Routinen
Herausforderungen und Risiken
Verlust der Wettbewerbsfähigkeit
Mögliche Konflikte bei der Regelung der Rechte am geistigen Eigentum
Änderung der Unternehmenskultur
Integration und Verarbeitung externer Daten und Informationen
Entwicklung von Situationen / Partnerschaften, in denen nicht nur eine Seite profitiert
Zusammenarbeit zwischen, zum Teil, unterschiedlichen Unternehmensgrößen (z.B. Konzerne und SMEs)
Formen der Open Innovation
Eine wesentliche Unterscheidung bei der Open Innovation muss zwischen dem Outside-In-Prozess, dem Inside-Out-Prozess und dem Coupled-Prozess gemacht werden.
Outside-In-Prozesse
Externe Netzwerke: Externe Netzwerke dienen dazu Informationen und Wissen in die eigenen unternehmensinternen Innovationsprozesse einfließen zu lassen. Besonders bei komplexen, zukunftsorientierten und disruptiven Fragestellungen, bei denen das Unternehmen keine oder nur wenige Erfahrungen oder Kompetenzen besitzt, macht ein externes Netzwerk Sinn.
Innovation Hubs können als die professionellste Form eines Netzwerks im Kontext der Open Innovation betrachtet werden. Vor allem für die Suche nach Innovationsmöglichkeiten durch disruptive Technologien, wie beispielsweise Blockchain oder künstliche Intelligenz, gründen einige Unternehmen und Konzerne Innovation Hubs, an denen Universitäten, Forschungseinrichtungen, Berater oder Technologie Start-Ups teilnehmen. Ein Beispiel hierfür ist der Lufthansa Innovation Hub.
Joint Venture: Das Joint Venture kann ebenfalls als eine Form der Open Innovation betrachtet werden. Ein Joint Venture dient vor allem dazu Ressourcen und Fähigkeiten zweier oder mehrerer Unternehmen zu bündeln, um auf diese Weise Marktvorteile generieren zu können. Besonders häufig bilden sich Joint Ventures in disruptiven Märkten und einer damit einhergehenden Verschiebung des Wettbewerbes. So haben beispielsweise BMW und Mercedes fünf gemeinsame Joint Ventures gegründet, um unter anderem in den Bereichen Car-Sharing, Elektro-Antrieb und Self-Driving Technology Kompetenzen zu bündeln. Diese strategische Entscheidung wurde getroffen um im Wettbewerb gegen neue große Unternehmen wie Google oder Uber bestehen zu können.
Customer Involvement: Die Einbeziehung des Kunden in den Innovationsprozess kann an unterschiedlichen Stellen erfolgen. Häufige werden Kunden im Rahmen des Prototypings eingebunden, um eine bereits entwickelte Innovation unter anderem hinsichtlich Funktionalität und Marktreife zu überprüfen. Darüber hinaus werden Kunden aber auch bereits zur Identifizierung und Entwicklung von Innovationsideen mit eingebunden. Diese Einbindung kann in Form von einzelnen Workshops erfolgen, oder aber auch als ständiger Prozess innerhalb des Innovationsmanagements.
Mergers and Acquisitions (M&A): Bei Mergers and Acquisitions handelt es sich um die radikalste Form der Internalisierung unter anderem von Informationen und Wissen. Unternehmenskäufe machen vor allem dann Sinn, wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist entsprechende Strukturen, Prozesse, Kompetenzen in einer bestimmten Zeit selbst aufzubauen. So hat beispielsweise Facebook im Zuge seines Vorhabens sich im Bereich Virtual Reality strategisch zu positionieren, 2014 das auf VR spezialisierte Tech-Unternehmen Oculus gekauft.
Inside-Out und Coupled-Prozesse
Die Bedeutung des Inside-Out-Prozesses liegt bei der Open Innovation in der Externalisierung von Informationen und Wissen, beispielsweise in Form von Open Source. So hat Tesla beispielsweise Teile seines Sicherheitscodes als Open Source veröffentlicht. Auf diese Weise kann der Code schneller weiterentwickelt und Fehler besser gefunden werden.
Neben Inside-Out und Outside-In Prozessen liegen häufig auch Coupled-Prozesse vor. Hierbei handelt es sich um eine hybride Form, bei der sowohl externe Informationen in die internen Innovationsprozesse eingebunden, als auch interne Daten und Informationen nach außen weitergegeben werden. Klassische Beispiele hierfür sind Joint Ventures, Innovationsnetzwerke oder Innovationswettbewerbe.
Open Innovation aus Sicht der internen Organisation
In vielen Vorstands- und Führungsetagen dominiert noch immer das Verständnis von Innovation als geschlossener interner Prozess. Neben dem häufig risikoaversen Mindset von Open Innovation auf Managementebene, gibt es auch oft Probleme bei der Einführung und Durchführung offener Innovationsprozesse auf Ebene der Mitarbeiter.
Ein Problem ist, dass häufig viele Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung Anreiz- und Belohnungssysteme eingebunden haben. Bei der Öffnung des Innovationsprozesses fürchten Mitarbeiter nun um diese Belohnungen, wodurch der Austausch zwischen Unternehmen und externen Innovationspartnern gebremst wird. Flexiblere Anreiz- und Belohnungssysteme müssen daher entwickelt werden.
Ein weiteres Problem ist, dass Mitarbeiter in offenen Innovationsprozessen dazu tendieren den Austausch mit den Kollegen des Netzwerkpartners zu suchen, die ihnen am angenehmsten sind. Auf diese Weise können durch ein zu geringes Commitment des Managements und der Führungsebene Strukturen des „Komforts“ entstehen, die aber nicht unbedingt die höchste Effizienz erbringen. Open Innovation Management benötigt daher auch ein Innovationsmanagement auf Makro-Ebene mit dem Ziel der Erhöhung von Komplexität, Dynamik und somit auch der Resonanzfähigkeit des Open Innovation Netzwerks.
Das Not-invented-here-Syndrom kann ebenfalls dem Erfolg einer Open Innovation entgegenstehen. Es besagt, dass externes Wissen allein aufgrund der Tatsache, dass es externes und nicht eigenes Wissen ist, weniger oder überhaupt nicht beachtet wird. Ein kultureller Unternehmenswandel, als langfristig angelegtes Projekt, ist daher elementar für den Erfolg von Open Innovation.
Die Integration von Daten und Informationen erfordert nicht nur eine entsprechende IT-Struktur und agile IT-Systeme. Baut ein Unternehmen im Rahmen der Open Innovation ein Netzwerk oder eine Partnerschaft auf, bedarf es über die notwendigen daten- und informationsverarbeitende Systeme hinaus die Kompetenz, Ressourcen und das Know-how in dem Bereich, für den es die Partnerschaft überhaupt erst benötigt. Denn häufig scheitern Open Innovation Projekte dadurch, dass die Unternehmen zwar Input erhalten, an dieser Stelle aber über keine oder zu wenig interne Kompetenzen verfügen, die für die Bewertung und Weiterverarbeitung des Inputs notwendig sind.
Quellen
Chesbrough, H., and Bogers, M. (2015) Explicating open innovation: Clarifying an emerging paradigm for understanding innovation. In New Frontiers in Open Innovation, ed. Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, and Joel West, S. 3–28. Oxford, UK: Oxford University Press.
Gustetic, J. L. et al. (2015) Outcome-driven open innovation at NASA. Space Policy, S. 11 – 17.
Lichtenthaler, U. (2011) Open innovation: past research, current debates, and future directions. Acad. Manag. Perspect., 25, S. 75-93.
Parida, V., P. Oghazi, and Å Ericson (2014) Realization of Open Innovation: A Case Study in the Manufacturing Industry. Journal of Promotion Management, 20 (3), S. 372–389.
Salter, A., Criscuolo, P. and Ter Wal, A. L. J. (2014) Coping with Open Innovation: RESPONDING TO THE CHALLENGES OF EXTERNAL ENGAGEMENT IN R&D. California Management Review, 56 (2), S. 77–94.


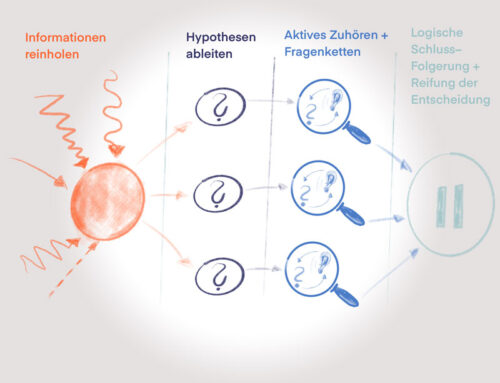
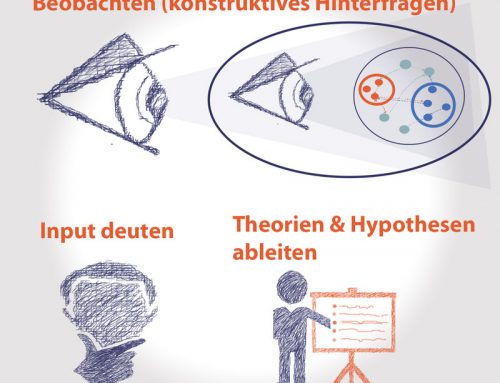
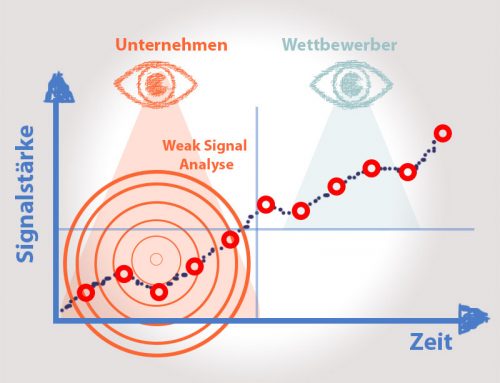
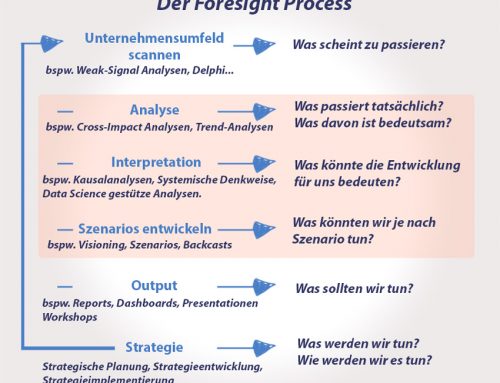
Hinterlassen Sie einen Kommentar